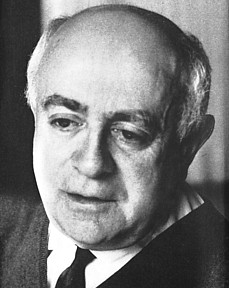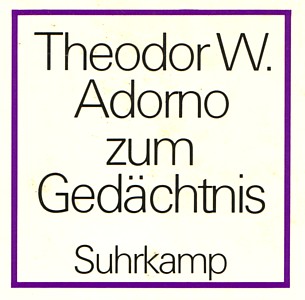|
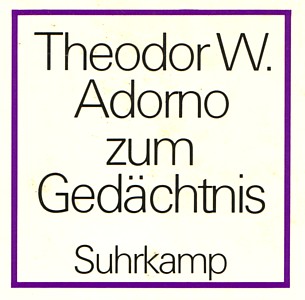 Marcuse:
Den Tod Adornos zu begreifen, fällt mir schwer wie allen Nahestehenden.
Eine Würdigung des Werkes schon geben zu können, bezweifle ich.
Es gibt andere Gründe, Adorno zurückzurufen. Ich muß heute
und hier ihn zurückrufen, weil gerade in der letzten Zeit Differenzen
bekannt geworden sind zwischen mir und ihm, die in verschiedener Weise
- gutwillig oder böswillig - entstellt wurden. Diese Differenzen
- und das muß von vornherein gesagt werden - entstanden auf dem
Grunde einer Gemeinsamkeit und einer Solidarität, die durch sie in
keiner Weise geschwächt worden sind. Marcuse:
Den Tod Adornos zu begreifen, fällt mir schwer wie allen Nahestehenden.
Eine Würdigung des Werkes schon geben zu können, bezweifle ich.
Es gibt andere Gründe, Adorno zurückzurufen. Ich muß heute
und hier ihn zurückrufen, weil gerade in der letzten Zeit Differenzen
bekannt geworden sind zwischen mir und ihm, die in verschiedener Weise
- gutwillig oder böswillig - entstellt wurden. Diese Differenzen
- und das muß von vornherein gesagt werden - entstanden auf dem
Grunde einer Gemeinsamkeit und einer Solidarität, die durch sie in
keiner Weise geschwächt worden sind.
Seiffe: Worin sehen Sie heute die besondere Stellung Adornos?
Wo gibt es eine Solidarität?
Die Solidarität heute ist da, wo sie eigentlich immer gewesen ist,
nämlich in der Radikalität des Denkens. Ich glaube, es gibt
niemanden, der so wie Adorno der bestehenden Gesellschaft radikal gegenüberstand,
der sie so radikal gekannt und erkannt hat. Sein Denken war so kompromißlos,
daß er sich selbst den Erfolg in dieser Gesellschaft leisten konnte.
Dieser Erfolg hat sein Denken in keiner Weise infiziert, in keiner Weise
kompromittiert. Man spricht manchmal von kompromittierenden Formen seines
Verhaltens. Ich glaube, über diese Formen ist dasselbe zu sagen.
Sie haben seiner Radikalität nicht das Geringste angetan. Ich sehe
in ihnen die bewußte Aufrechterhaltung von Formen einer vergangenen
Kultur und zwar - vielleicht - aus Schutz vor der aufdringlichen, brutalen,
falsch-egalitären Vertraulichkeit des Bestehenden; ein Pathos der
Distanz, Formen der Höflichkeit, Formen der Härte, die vielleicht
auch Angst bekunden vor zu großem Mitleid mit dem, was den Menschen
angetan wurde - Mitleid, das vielleicht die notwendige Rücksichtslosigkeit
der Kritik beeinträchtigen könnte. Mir jedenfalls waren diese
aristokratischen Formen seines Verhaltens immer besonders liebenswert.
War es nicht so, daß Adorno zwar der bestehenden Gesellschaft radikal
gegenüberstand, einer ihrer sicherlich unbestechlichsten Kritiker war,
aber daß seine Radikalität doch eine rein theoretische blieb?
[page 48] Gab es da nicht eine Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis?
Ich glaube, daß ihm der Schreck vor dem Bestehenden so im Hirn
und in den Gliedern saß, daß für ihn Leben und Denken
eins waren. Er hat zeit seines Lebens nach Formen gestrebt, in denen der
Schrecken des Bestehenden wirklich sichtbar gernacht und mitteilbar gemacht
werden konnte. Er fand sich in einer Situation, in der es der bestehenden
Gesellschaft gelungen war, das Bewußtsein in solchem Grade zu ersticken
und zu manipulieren - selbst die Bedürfnisse in solchem Maße
zu manipulieren, daß die traditionellen Formen der Mitteilung und
besonders die der Umsetzung des kritischen Denkens in Praxis offenbar
nicht mehr als möglich erschienen. Und seine Antwort war ein Rückzug,
ein temporärer Rückzug auf das - sagen wir ruhig - reine Denken
(und mit reinem Denken meine ich hier kompromißloses Denken), aber
nur um allmählich und so wirkungsvoll wie rnöglich das Bewußtsein
der notwendigen Veränderung wieder zu entwickeln und damit die notwendige
Veränderung vorzubereiten.
Aber hat er sich nicht, jedenfalls in der letzten Zeit, ganz entschieden
abgeriegelt gegen jede Praxis, und zwar mit ganz anderen Argumenten, nämlich
indem er sagte, Aufgabe der Kritischen Theorie sei es, gesellschaftliche
Mißstände zu erkennen und zu benennen, aber nicht die Erkenntnis
umzusetzen in die Wirklichkeit, also praktische Folgerungen zu ziehen?
Ich habe diese Erklärung immer so verstanden, daß es in der
gegebenen Situation nicht die Aufgabe der Kritischen Theorie ist, sich
unmittelbar in die Praxis umzusetzen. Das heißt also: wenn eine
Trennung zwischen Theorie und Praxis besteht, dann ist es sicher nicht
das Werk Adornos, sondern das Werk - sagen wir ruhig - die Schuld der
Wirklichkeit, auf die Adorno nur reagiert, auf die er reflektiert hat.
Und die Wirklichkeit läßt keine Praxis mehr zu?
Das würde ich nicht sagen. Hier liegt eine der Differenzen zwischen
mir und ihm, aber um sie klarzumachen, muß ich erst sagen, was mit
der Schuld der Wirklichkeit hier eigentlich gemeint sein kann. Ich denke
daran, daß der Spätkapitalismus Formen der Repressionen entwickelt
hat, die die in der Marxischen Theorie traditionelle Praxis der Veränderung
unmöglich zu machen scheint. [page 49] Und ich denke hier besonders
an die Integrierung weiter Schichten der Bevölkerung,besonders an
die Integrierung der Arbeiterklasse in das bestehende kapitalistische
System in den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern. Das heißt
aber, daß das geschichtliche Subjekt, das gesellschaftliche Subjekt
der Revolution offenbar nicht mehr da war, oder offenbar nicht mehr oder
noch nicht aktiv war. An dieser Stelle war er orthodoxer Marxist. Ohne
eine Massenbasis in den ausgebeuteten Klassen ist eine Revolution unvorstellbar.
Und weil diese Massenbasis in der gegebenen Situation gerade in den fortgeschrittenen
kapitalistischen Ländern nicht sichtbar war, hat er sozusagen die
Umsetzung der Theorie in die Praxis vertagt. Er hat immer wieder nach
den Vermittlungen gesucht, die, ohne die Möglichkeit einer solchen
Umsetzung aufzugeben oder zu verraten, wenigstens die Umsetzung der Theorie
in die Praxis vorbereiten könnten.
Aber es gab doch auch andere Differenzen. Ich denke da an die verschiedene
geschichtliche Einschätzung der Funktion der Studentenbewegung.
Diese Differenzen in der Einschätzung der Studentenbewegung gehören
in denselben Zusammenhang des Theorie-Praxis-Problerns. Zunächst
einmal muß doch wieder gesagt werden, daß Adorno von Anfang
an auf seiten der Studentenbewegung gestanden hat, die wenigstens in Deutschland
ohne sein Werk unvorstellbar ist. Und die Studentenbewegung sollte nicht
vergessen, daß sie eine intellektuelle Bewegung ist und daß
sie von der Theorie lebt, selbst dort noch, wo sie die Theorie verlacht.
Aber Adorno hat - und das sind seine eigenen Worte - in der Studentenbewegung
keine gesellschaftsverändernde Kraft gesehen, und genau deswegen
hat er, was er Aktionismus nannte, abgelehnt. Er war der Ansicht, daß
Aktionen, die keinen gesellschaftlichen Boden haben, auch keine gesellschaftliche
Kraft haben können; daß sie nicht Ausdruck der Hoffnung, sondern
Ausdruck der Verzweiflung sind, und daß sie sehr leicht dem Feind
in die Hände spielen können. Es gibt in dem neuen Rahmen der
Opposition Aktionen, die mit linker Politik nicht das geringste zu tun
haben, entartete Formen, die ich genauso widerwärtig finde, wie Adorno
sie gefunden hat. Dazu gehört zum Beispiel die mutwillige Zerstörung
von Büchern, aber auch Gewaltanwendung gegen gewaltlose Personen.
Das hat mit radikaler Politik nichts zu tun und ist eine Entartung, in
deren Verurteilung ich mit Adorno einig bin. [page 50]
Die meisten der Nachrufe, die kurz nach dem Tode Adornos in der Presse erschienen,
haben eines ausgeklammert: daß Adorno Marxist war. Wie sehen Sie sein
Verhältnis zur Marxischen Gesellschaftskritik?
Ja, ich muß sagen, daß mich diese Ausklammerung auch überrascht
- eigentlich nicht überrascht, aber aufs höchste befremdet hat.
Ich sehe in Adorno einen der ganz wenigen, die die Marxische Theorie in
ihren tiefsten Intentionen weiterbetrieben haben. Die Dynamik der kapitalistischen
Gesellschaft und ihre Negation ist durch sein Werk in allen Bereichen
der Kultur sichtbar gemacht worden. Eine technisch vollendete und exakte
Analyse eines Werkes zeigt die Gesellschaft selbst in den abstraktesten
und sublimsten Bereichen der intellektuellen Kultur. Ein Quartett Schönbergs
zum Beispiel, ein Passus in Kants 'Kritik der reinen Vernunft', aber auch
eine alltägliche Geste - was es immer sei - wird einer kritischen
Analyse unterworfen, vorgetrieben bis zu dem Punkt, wo das Werk selbst,
das Quartett, der Text, die Geste hergibt, in welcher Weise diese Manifestation
mit der Struktur der kapitalistischen Gesellschaft und ihrer möglichen
Negation verbunden ist. Ich kenne niemanden, der in dieser Weise eine
marxistische Analyse in der Kultur betrieben hat und dem sie in dieser
Weise gelungen ist. Für ihn war das Resultat der Analyse: so kann
es nicht weitergehen, aber es geht weiter. Und solange es weitergeht,
ist eben die Aufgabe der Kritischen Theorie, die Aufgabe der Marxistischen
Theorie, weiter zu denken, radikaler zu denken und diese Radikalität
des Denkens anderen mitzuteilen. Die Frage bleibt nun, ob nicht - und
inwieweit der Stil Adornos dieses Ziel verstellt, und inwieweit nicht
seine Distanz von der Praxis durch diesen Stil perpetuiert wird. Das hat
man oft gesagt, und ich selbst habe behauptet, daß die Kritische
Theorie heute in viel gröberen und in viel simplifizierteren Formen
dargestellt werden muß, um den radikalen Inhalt wirklich mitteilen
zu können und ihn nicht über Gebühr zu sublimieren. Ich
weiß, daß gerade in diesem Punkt Adorno nicht mit mir einig
war. Er hat immer geglaubt - und es scheint, daß er weitgehend recht
hat -, daß die Substanz seines Werkes von der Form, in der sie präsentiert
wird, eben nicht zu trennen ist. Seine Sprache ist getrieben von der Angst,
nicht der Verdinglichung zu verfallen, derselben Angst wie ich schon vorher
erwähnte -, nicht zu schnell und zu leicht [51] vertraut und vertraulich
zu werden und dadurch falsch verstanden zu werden. Ich gebe zu, daß
mich die Sätze Adornos manchmal in Raserei gebracht, manchmal wütend
gemacht haben, aber ich glaube, das sollten sie. Und ich glaube, ich brauche
mich dessen nicht zu schämen.
Wie wird es weitergehen ohne die Auseinandersetzung mit Theodor Adorno?
Wie es weitergehen soll ohne die Auseinandersetzung mit Theodor W. Adorno,
kann ich mir gar nicht vorstellen. Jedenfalls sind die Differenzen zwischen
mir und ihm in dem Sinne gegenstandslos geworden, daß es keinen
gibt, der Adorno vertreten und der für ihn sprechen kann. Was ich
ihm zu verdanken habe, ist unendlich viel, und ich kann mir ohne sein
Werk ein Weiterleben nicht vorstellen. Das heißt aber, daß
die Auseinandersetzung mit seinem Werk doch noch kommen wird, kommen muß,
daß sie noch nicht einmal begonnen hat. |